Was hat Corona mit der Gesellschaft gemacht?

Foto: H.S.
06.09.2025 - von Dr. Bettina Kohlrausch
„Es ist ernst, also nehmen Sie es auch ernst.“ Mit diesen Worten schwor die damalige Kanzlerin Angela Merkel die Bevölkerung im März 2020 auf die Bedrohung durch ein bis dahin unbekanntes Virus ein. Wenige Wochen später veränderte der erste Lockdown das Leben fast aller Menschen in Deutschland fundamental.
Der Bundestag hat nun eine Enquete-Kommission eingerichtet, um diese Zeit aufzuarbeiten. Fünf Jahre nach der Pandemie ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu fragen, was wir als Gesellschaft aus der Pandemie lernen können. Dabei ist klar: Die Corona-Pandemie war nicht nur eine Gesundheitskrise – sie war eine gesellschaftliche Krise.
Es ist daher wichtig, dass sozialwissenschaftliche Erkenntnisse in die Arbeit der Kommission einfließen. Das WSI hat diese Zeit intensiv begleitet und die wichtigsten Befunde in dem im Campus-Verlag erschienen und im open-access erhältlichen Buch: „Was von Corona übrig bleibt“ veröffentlicht. Die Befunde zeigen, dass wir aus der Pandemie nicht nur für kommende Krisen, sondern auch für die Gestaltung aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen lernen können.
So waren schwächere Arbeitsmarktgruppen durch die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Krise unverhältnismäßig stark belastet. Dies lag vor allem daran, dass sich die sozialstaatliche Absicherung von Beschäftigung immer noch zu stark an einem traditionellen Verständnis von abhängiger, männlicher Vollzeiterwerbstätigkeit orientiert. In der Krise sind jedoch zum Beispiel auch viele Selbstständige auf den Schutz der Solidargemeinschaft angewiesen gewesen.
Auch unbezahlte Sorgearbeit hat unter dem Gesichtspunkt der sozialstaatlichen Absicherung so gut wie keine Rolle gespielt. Es ist eine große Leerstelle der Pandemiepolitik, dass sie die Relevanz von Sorgearbeit ausgeblendet hat – als gesellschaftliche Aufgabe wie auch als ein für die Erwerbsfähigkeit bestimmender Faktor. Und es waren überwiegend die Frauen, die den Preis dafür gezahlt haben.
Auch für Jugendliche, die pandemiebedingt keinen Ausbildungsplatz erhielten oder unter erschwerten Bedingungen an der sogenannten ersten Schwelle zwischen Schule und Ausbildung standen, gab es keine gesonderten Unterstützungsangebote. Es ist davon auszugehen, dass die fehlende Ausbildung bzw. ein verspäteter oder gescheiterter Berufseinstieg nachhaltige Spuren in ihren Bildungs- und Erwerbsbiografien hinterlassen werden. Insgesamt ist die Zahl der Menschen ohne formal qualifizierenden Abschluss, also ohne einen Berufsabschluss, während der Pandemie stark gestiegen.
Die genannten Beispiele zeigen, dass die Pandemie Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen hat, die dringend politisch bearbeitet werden sollten. Wenn die Enquete-Kommission dazu einen Beitrag leistet, wäre das eine gute Sache.
Prof. Dr. Bettina Kohlrausch ist die Wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung.
Podcast: Systemrelevant - Was hat Corona mit der Gesellschaft gemacht? Link
anhören auf youtube unter:Link
Was von Corona übrig bleibt - Erwerbsarbeit, Sozialstruktur, gesellschaftliche Folgen:
Bettina Kohlrausch (Hg.), Eileen Peters (Hg.), Karin Schulze Buschoff (Hg.)– als Print und kostenfreies E-Book unter: Link
Weitere Artikel, nach dem Datum ihres Erscheinens geordnet, zum Thema
Gesundheit:
26.08.2025: Droht nach 20 Jahren neue Praxisgebühr ?
24.07.2025: Jens SPahn und die Maskenbeschaffung, die Medikamentenbeschaffung und ...
15.07.2025: Sport verlängert das irdische Dasein auch wenn jemand spät damit beginnt
Alle Artikel zum Thema
Gesundheit
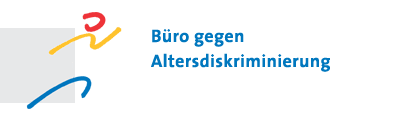
 Seite
drucken
Seite
drucken