Berlin: Labour Environmentalism: Krise, Perspektiven und Strategien
01.12.2025
Labour Environmentalism: Krise, Perspektiven und Strategien
Internationale Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung vom 1.Dezember 2025 09:00 Uhr bis 02.Dezember 2025, 16:30 Uhr
Um der sich zuspitzenden sozial-ökologischen Krise noch begegnen zu können, ist eine grundlegend andere Organisation von Arbeit, Produktion und sozialer Reproduktion unerlässlich. Ohne neue internationale Allianzen zwischen Arbeiter*innen-, Umwelt- und feministischen Bewegungen, NGOs und transformativen Gruppen in verschiedenen Organisationen ist dies nicht zu erreichen. Diese Allianzen zu bilden, ist jedoch eine enorme Herausforderung, denn weltweit sehen sich emanzipatorische Akteure mit rückschrittlichen Entwicklungen konfrontiert: Fossile Kapitalfraktionen verspüren ebenso Aufwind wie autoritäre oder gar faschistische Kräfte; auf fossilen Lebensweisen basierende Subjektivitäten und traditionelle (männliche) Identitäten werden gestärkt; geopolitische Spannungen verschärfen sich und entladen sich in Kriegen; die Produktion von Waffen, die auch ohne deren Einsatz in Kriegen sehr ressourcen- und emissionsintensiv ist, wird massiv ausgeweitet; und Interessengegensätze zwischen Arbeiter*innen und Ökologie nehmen zu – nicht nur aufgrund fossiler Abhängigkeiten, sondern auch weil dominante Politiken der ökologische Modernisierung oft zulasten von Beschäftigten gehen.
Gleichzeitig lassen sich vielversprechende und fortschrittliche Ansätze beobachten, die gesellschaftlich bislang allerdings randständig sind: Menschen aus verschiedenen sozialen Bewegungen und Gewerkschaften suchen gemeinsam nach inklusiven und radikalen Alternativen in Bereichen wie Wohnen, Energie, Mobilität und Industrieproduktion. Dabei stellen sie auch vorherrschende Konzepte von Arbeit und Arbeitsteilung, von Hand- und Kopfarbeit sowie von Produktion und Reproduktion in Frage. Sie orientieren sich an Prinzipien der Fürsorge und der sozialen Reproduktion, der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit, der radikalen Demokratie und der Umwelt- und Klimagerechtigkeit. Fortschrittliche Ansätze zeigen sich auch in gewerkschaftlichen Diskussionen und im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung (just transition, Demokratiezeit, u.a.). In akademischen Debatten wird all dies auch unter dem Begriff des labour environmentalism diskutiert.
Diese widersprüchlichen Entwicklungen stellen eine analytische ebenso wie eine politische Herausforderung für kritische Wissenschaft sowie emanzipatorische gesellschaftliche und politische Akteure dar. Es geht darum, die rückschrittlichen Tendenzen besser zu verstehen, um den progressiven zum Durchbruch zu verhelfen: Wie wird die ökologische Krise in verschiedenen Teilen der Arbeiter*innenklasse wahrgenommen? Wie wird sie mit Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und mit Eigentumsfragen verknüpft? Warum wenden sich Teile der Arbeiter*innenbewegung in Zeiten schwerer sozial-ökologischer Verwerfungen nach rechts? Wie unterscheiden sich die Krisenerfahrungen von Arbeiter*innen entlang der Linien globaler Süden/globaler Norden, Industrie/Landwirtschaft, Produktion/gesellschaftliche Reproduktion? Wo und unter welchen Voraussetzungen werden Krisenerfahrungen regressiv oder progressiv politisiert? Welche Rolle spielen dabei Allianzen, die bestehende Trennlinien überwinden?
Die Konferenz will einen Raum bieten, um diese drängenden Fragen zu diskutieren. Zu diesem Zweck bringt sie Wissenschaftler*innen mit Aktivisten*innen aus sozialen Bewegungen und Gewerkschaften sowie mit Beschäftigten und Betriebsrät*innen aus verschiedenen Ländern zusammen. Ziel ist es, in Plena und Workshops die Krise und die Perspektiven des labour environmentalism zu analysieren und Ideen für die gemeinsame zukünftige Arbeit und Vernetzung zu entwickeln.
Eine Veranstaltung von Arbeiterkammer Wien, Global Labour University, Institute for International Political Economy der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien, next economy lab, Norbert Elias Center for Transformation Design & Research der Europa-Universität Flensburg, Sonderforschungsbereich «Strukturwandel des Eigentums» an der Universität Jena und der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Programm
Montag, 1. Dezember
09:00 Anmeldung, Kaffee
09:30 Begrüßung und Einführung in die Tagung
Heinz Bierbaum (Vorstandsvorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung) und Markus Wissen (Institut für internationale politische Ökonomie der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin)
10:00 Vortrag: Petro-masculinity and the political ecology of labor
Englisch mit deutscher Übersetzung
Cara Daggett, Virginia Tech / Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Potsdam
11:00 Podium: Von grünen new deals zum autoritären Kapitalismus? Fossile Gegenoffensive, Militarisierung, Faschisierung und ihre Bedeutung für einen labour environmentalism
Englisch mit deutscher Übersetzung
Stefanie Hürtgen, Universität Salzburg
Emanuele Leonardi, Universität Bologna
Silpa Satheesh, Indian Institute of Management Kozhikode
Simon Schaupp, Technische Universität Berlin
Moderation: Melanie Pichler, Universität für Bodenkultur Wien
12:30 Mittagspause
13:30 bis 15:15 Workshop-Phase I
Workshop A1: Historische und aktuelle Erfahrungen von Naturzerstörung und gesundheitlichen Problemen in der Arbeit mit der Kohle in den Revieren – Verbindungslinien für Arbeits- und ökologische Kämpfe?
In diesem Workshop geht es um Erfahrungen, die Arbeiter und Arbeiterinnen in der Kohle machen, und um die Frage der gesellschaftlichen und individuellen Naturverhältnisse darin (äußere Natur – menschliche Natur). Bekannt ist die starke Beziehung von Kohlearbeitern und -arbeiterinnen zu ihrer Arbeit und dem Arbeitskontext: Neben Produzentenstolz ist auch eine Identifikation und kulturelle Prägung typisch, die durch den kooperativen Schichtbetrieb entstand, und es wird die emotionale Verbundenheit mit der Kohle deutlich. Daneben wird in Interviews aber regelmäßig von negativen Folgen der Kohlearbeit berichtet, von mangelnder Selbstsorge, Krankheiten, Unfällen und Tod. Auch die Trauer um abgebrochene Orte und Ohnmachtserfahrung zeugen von Ambivalenzen. Der Workshop wird zunächst Forschungsinterviews u.a. Material präsentieren und Einblick in sozialwissenschaftliche Empirie geben: In anonymisierter Form können Erfahrungen von Kohlearbeitern und -arbeiterinnen vernommen werden. Dies wird anschließend zum Gegenstand eines Gesprächs zwischen Forschung und Praxis aus Ost und West. Zentrale Frage dabei ist: Wie können ambivalente Erfahrungen mit der eigenen und äußeren Natur in der Kohlearbeit, ihrer Beherrschung und deren Folgen in die Aushandlung von Konflikten in den Revieren einbezogen werden?
Sprache: Deutsch
Verantwortliche: Virginia Kimey Pflücke (Postdoc, Wirtschafts- und Arbeitssoziologie, BTU Cottbus-Senftenberg); Janina Puder (Gastprofessorin, Sozialökologische Transformation, BTU Cottbus-Senftenberg); Diskussion mit Maximilian Hauer (Co-Autor: Klima und Kapitalismus, 2024) und Praxispartner*innen aus den Gewerkschaften, Betriebsräten und sozialökologischen Protesten.
Workshop B1: Transformation und Mitbestimmung: Zwischen Aufbruchstimmung, Ängsten und rechten Erfolgen. Perspektiven aus Europa und Argentinien – Teil 1
Der Workshop besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Teilen. Das übergeordnete Ziel ist die Analyse gegenwärtiger rechtsautoritärer Mobilisierungen in der Transformation sowie eine Diskussion, ob und inwieweit demokratische Beteiligung in der Arbeitswelt geeignet ist, diesen entgegenzutreten. Im ersten Teil werden internationale Perspektiven auf das Erstarken rechter und zugleich klimaskeptischer Parteien unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiter*innenklasse beleuchtet und im Länder- bzw. Nord-Süd-Vergleich diskutiert. Dabei fokussieren wir zunächst auf Europa und Deutschland; anschließend kontrastieren wir dies mit Argentinien, wo die extrem rechte Regierung Mileis ein antistaatliches, gewerkschaftsfeindliches und anti-ökologisches Regierungsprojekt repräsentiert, das unter Arbeiter*innen dennoch erhebliche Zustimmung findet. Im zweiten Teil fragen wir nach Ansatzpunkten für eine politische Praxis in der Arbeitswelt. Vorgestellt werden sowohl umfassende wirtschaftspolitische Transformationskonzepte als auch konkrete Fallstudien, die aufzeigen, unter welchen Bedingungen die demokratische Gestaltung von Transformationsprozessen miss- bzw. gelingt. Unter anderem wird die Rolle von Eigentumsverhältnissen und (fehlender) Mitbestimmung in unterschiedlichen Sektoren thematisiert.
Teil 1: Bestandsaufnahme und Internationale Perspektiven
Andreas Hövermann (WSI): Transformationsängste als Rohstoff rechter Mobilisierungen – demokratische Beteiligung als Antwort
Sol Klas & Gerardo Juara (Frente Sindical de Acción Climática, Argentinien): Gewerkschaftliches Klimaengagement angesichts aktueller Herausforderungen (online zugeschaltet, Übersetzung via zoom)
Einleitung und Moderation: Anne Tittor (SFB 294 „Strukturwandel des Eigentums“, Universität Jena) & Neva Löw (WSI)
Sprache: Der Workshop findet in hybrider Form auf Deutsch und Spanisch statt. Es gibt eine spanisch-deutsche Übersetzung beider Workshopteile via zoom. Wer in Berlin der spanischen Übersetzung folgen will, benötigt ein eigenes internetfähiges Endgerät (z.B. Smartphone) sowie dafür geeignete Kopfhörer.
Verantwortliche: Max Knapp (AK Wien), Steffen Liebig, Maria Pfeiffer & Anne Tittor (SFB 294 „Strukturwandel des Eigentums“, Universität Jena), Neva Löw & Stefan Schoppengerd (WSI), in Kooperation mit dem Momentum Institut & dem Netzwerk TraSAs
Workshop C1: Zur Ökologie der lebendigen Arbeit. Erschöpfung von Arbeiter*innen und Natur – das Beispiel der transnationalen Automobil- und Batterieproduktion
In den meisten Diskussionen, die Arbeit und Ökologie miteinander verbinden wollen, lag der Schwerpunkt bisher auf der Sicherung von Arbeitsplätzen: Die Umstrukturierung der Kohle- und Stahlindustrie, aber auch der Automobilindustrie soll auf „sozialverträgliche“ Weise erfolgen, beispielsweise durch Umschulungen oder soziale Sicherheitsnetze. Gegen soziale Sicherheit ist nichts einzuwenden, aber für einen „Labor Environmentalism“ greift das zu kurz. Denn Arbeit und Natur sind keine getrennten Bereiche. Arbeit ist an menschliche Vitalität, an immer schon soziale Lebendigkeit gebunden: z. B. Dessen Kraft, Spontaneität und Kreativität. Denken wir Arbeit und Natur zusammen wird sichtbar: die Erschöpfung von Mensch und Natur muss als miteinander verbunden betrachtet werden.
Der Workshop wird sich mit diesem Zusammenhang zwischen der Erschöpfung der Natur und der Erschöpfung der (lohn-)arbeitenden Menschen am Beispiel der heutigen Automobil- und Batterieproduktion befassen. Einerseits werden die global zerstörerischen natürlichen Bedingungen (Stichwort: Lithiumproduktion) untersucht. Andererseits wird der Workshop auch explizit die aktuellen industriellen Arbeitsbedingungen in der (Elektro-)Auto- und Batterieproduktion in Europa thematisieren, da diese in vielen ökologischen Diskussionen bislang weitgehend unbekannt sind. Ziel des Workshops ist es, anhand konkreter Beispiele (aus Ungarn, Italien, Frankreich, Deutschland und anderen Ländern) den Zusammenhang zwischen Ausbeutung und Erschöpfung von Natur und Arbeiter*innen zu diskutieren und nach politischen Konsequenzen fragen.
Sprache: Englisch (mit Übersetzung und Möglichkeiten deutscher Diskussions-Beiträge)
Verantwortlich: Stefanie Hürtgen (Universität Salzburg); mit Beiträgen von Krisztofer Boder, Angelo Moro, Clelia Li Vigni
Workshop D1: Subjektive Transformationsblockaden und ihre Überwindung: Sozial-ökologische Betriebserfahrungen und Handlungspotenziale in anti-transformativen Arbeiter*innenmilieus
Der Workshop fragt aus einer betriebs- und subjektzentrierten Perspektive nach Anknüpfungspunkten für eine sozial-ökologische Politik in Beschäftigtengruppen, die tendenziell als skeptisch gegenüber Klimapolitik und -bewegungen gelten. Im Fokus stehen nicht-akademische, manuell-technische Tätigkeiten und damit gerade jene Gruppen, die in klimapolitisch zentralen Branchen wie zum Beispiel Bau, Energie, Chemie oder Automobil arbeiten. In Umfragen zu Klimaeinstellungen gelten sie tendenziell als weniger besorgt und engagiert gegenüber Umweltthemen dafür als offener gegenüber rechts-autoritären, antidemokratischen Politikangeboten. Dieser Befund wiegt umso schwerer, als es auch genau diese Gruppen für eine erfolgreiche ökologische Transformation zu gewinnen gälte. Der Workshop geht den Grenzen sozialverträglicher Transformationsansätzen nach und rückt die Subjektivitäten der Beschäftigten und ihre spezifischen Erfahrungs- und Interpretationsmuster in den Fokus, um subjektiv-gesellschaftsstrukturelle Transformationsblockaden verstehen und perspektivisch überwinden zu können. Welche Rolle spielen beispielsweise konkrete betriebliche Arbeitserfahrungen für ablehnende Haltungen gegenüber klimapolitischen Vorgaben und Akteuren? Welche Brüche und Widersprüche finden sich hierbei? Schließlich sollen sozial-ökologische Handlungspotentiale dieser Gruppen identifiziert und aus einer gewerkschafts- wie klimapolitischen Praxisperspektive erörtert werden.
Sprache: Deutsch
Verantwortliche: Hans Rackwitz, Thomas Barth (beide IfS Frankfurt am Main), mit Inputs von Ronja Endres (PECO e.V. – angefragt), Dirk und Nelia (Klimastreik Bern)
Workshop E1: Welche Strategien für sozial-ökologische Transformationskonflikte? Lehren aus einer internationalen Auswahl von Fallstudien und aktuellen Auseinandersetzungen bei Volkswagen Osnabrück – Teil 1
Die jüngsten Entwicklungen in der Automobilindustrie haben erneut deutlich gezeigt, dass der Wandel der Branche längst auch die Fabriken erreicht hat: in Form einer Krise, die drastische Einschnitte für die Beschäftigten mit sich bringt, sei es durch den „sozialverträglichen” Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen oder durch die Schließung ganzer Werke, wie im Fall von Ford Saarlouis oder möglicherweise dem Volkswagenwerk in Osnabrück. Die jüngste Eskalation der Ereignisse bei Volkswagen zeigt einmal mehr, dass die traditionellen Instrumente für eine sogenannte „Just Transition“ im Rahmen einer sogenannten „Sozialpartnerschaft”, die seit langem die deutschen Gewerkschaften und Betriebsräte leiten, an ihre Grenzen stoßen. Um ein Betriebsratsmitglied zu zitieren: „Ein Zukunftstarifvertrag ist kein nachhaltiges Produkt.”
Teil 1: Vergleichende Fallstudien
Dieser zweistufige Workshop beginnt mit der Vorstellung von drei Fallstudien zu aktuellen Transformationskonflikten: dem Kampf der Gewerkschaft LAB für die ökologische Umstellung von Mecaner Urduliz (Baskenland), dem anhaltenden Kampf des Fabrikkollektivs ehemaliger GKN-Beschäftigter in Campi Bisenzio (Italien), die für den ökologische Umbau ihres Werks kämpfen, und den Strategien gegen Stellenabbau und Standortverlagerung bei Mahle (Deutschland). Es werden einige Kritikpunkte am Mainstream-Konzept der gerechten Transition angesprochen, wobei einige dieser Auseinandersetzungen mit den Machtressourcen der Gewerkschaften und Diskussionen über deren Erneuerung in Verbindung gebracht werden. Nach kurzen Inputs der Referent*innen werden wir zu einer Diskussion in kleinen Gruppen übergehen.
Sprache: Englisch
Verantwortliche: Julia Kaiser (Universität Leipzig), Katharina Keil (Universität Lausanne), Martín Lallana (LAB Gewerkschaft – Baskenland)
Workshop F1: Unterschiedliche Wege, gemeinsame Ziele: Aufbau von Basisorganisationen und Nutzung von Top-Down-Partnerschaften zwischen Gewerkschaften und Klimabewegungen – Teil 1
Dieser zweiteilige Workshop bringt Organizer und Wissenschaftler*innen zusammen, um aus drei primären Fallstudien zu lernen, die das Spektrum von basisgeführten Aktionen bis hin zu Top-Down-Erfolgen in der Politik durch organisatorische Partnerschaften abdecken. Trotz der Unterschiede in Bezug auf Branche, Land und Ansatz wird unsere gemeinsame Analyse dieser Bewegungen den Teilnehmenden strategische Erkenntnisse liefern. Beide Teile des Workshops können unabhängig voneinander besucht werden. Teilnehmernde, die die Wechselwirkungen zwischen Top-down- und Bottom-up-Strategien verstehen und praktische Erkenntnisse für ihre eigenen Herausforderungen gewinnen möchten, wird die Teilnahme an beiden Teilen empfohlen.
Teil 1: Vom Hallenboden aus – Protagonismus von Arbeiter*innen und Aktivist*innen in Italien und Deutschland
Dieser Workshop vermittelt uns einen Einblick in die gelebte Erfahrung der Führung durch einfache Beschäftigte. Anhand von Beispielen wie GKN in Florenz und Präsentationen von Arbeiter*innen, die am Kampf gegen das Kohlekraftwerk von Enel in Torrevaldaliga Nord, Italien, beteiligt sind, sowie von Verkehrswendestadt Wolfsburg werden wir aus erster Hand erfahren, wie die Protagonistenrolle von Arbeiter*innen und Aktivist*innen entstanden ist und ihre Bewegungen verändert hat. Anhand gemeinsam erstellter Zeitachsen und Akteurskarten werden wir Strategien, Durchbrüche und Grenzen nachzeichnen. Die Just Transition Partnership in Schottland – gegründet vom Scottish Trades Union Congress und Friends of the Earth – erscheint hier als kontrastierender Fall: eine starke Top-down-Koalition, die nicht auf Werksebene oder an der Basis agiert. Wir werden untersuchen, warum das so ist und wo sich zukünftige Möglichkeiten bieten könnten. Diese erste Sitzung ist eher vortragslastig und vermittelt den Teilnehmenden zunächst die Perspektive der Arbeiter*innen, bevor wir in der folgenden Sitzung zur angewandten Strategie übergehen.
Die Teilnehmenden müssen nicht in der Gewerkschafts- oder Klimabewegung engagiert sein; wir werden Fallstudien für diejenigen bereitstellen, die aus anderen Perspektiven kommen oder über ihre unmittelbaren Kämpfe hinausdenken möchten.
Sprache: Englisch
Verantwortliche: Aaron Niederman (Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung), Anne Moeller (Europa-Universität Flensburg), Marco Caligari (University of Ferrara), Matthew Crighton (Just Transition Partnership)
15:15 Kaffeepause
15:45 bis 17:30 Workshop-Phase II
Workshop A2: Arbeit und die sozial-ökologische Transformation der Agrarindustrie
Die moderne agroindustrielle Landwirtschaft und ihre Wertschöpfungsketten tragen erheblich zur doppelten ökologischen Krise des Massensterbens und des Klimanotstands bei. Von der Linken werden in der Regel Ernährungssouveränität und kleinbäuerliche Landwirtschaft als Alternative vorgeschlagen. Dies geschieht trotz der Tatsache, dass agroindustrielle Wertschöpfungsketten zunehmend von prekarisierten Wanderarbeiter*innen abhängig sind, sowohl auf den Plantagen des Globalen Südens als auch in den kapitalintensiven Landwirtschaftssystemen in Europa, Nordamerika und China. Welche Rolle können Arbeiter*innen bei der Transformation dieser Industrien spielen? Können Bewegungen für Klimagerechtigkeit und Ernährungssouveränität Allianzen mit Arbeiter*innen eingehen? Und wie kann sinnvolle transnationale Solidarität entlang der Wertschöpfungskette aufgebaut werden? Der Workshop untersucht diese Fragen anhand der Entwicklung einer Perspektive für eine Just Transition in der Palmölindustrie in Indonesien. Es werden Beiträge dazu vorgestellt, wie Arbeiter*innen, Gewerkschaften und Aktivist*innen für Umweltgerechtigkeit soziale und ökologische Fragen in den Plantagen miteinander verknüpft haben, welche transformativen Visionen vorgebracht werden und welche ersten Schritte in Richtung einer transnationalen Zusammenarbeit unternommen wurden, um eine vergleichende und kritische Reflexion anzuregen. Die Antworten reflektieren, wie sozial-ökologische Transformationsstrategien für die Weiterverarbeitung in der Lebensmittelindustrie relevant werden könnten und ob eine Perspektive der Just Transition auch auf Wanderarbeit in der europäischen Landwirtschaft angewendet werden könnte.
Sprache: Englisch und Indonesisch
Verantwortliche: Oliver Pye (Universität Bonn), mit Beiträgen von Aisha Utami (Sawit Watch), Hariati Sinaga (Universitas Indonesia), Agyl Eka Pratama (SERBUK union), Benjamin Luig (Faire Mobilität), Susanne Uhl (NGG) (alle angefragt)
Workshop B2: Transformation und Mitbestimmung: Zwischen Aufbruchstimmung, Ängsten und rechten Erfolgen. Perspektiven aus Europa und Argentinien – Teil 2
Der Workshop besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Teilen. Das übergeordnete Ziel ist die Analyse gegenwärtiger rechtsautoritärer Mobilisierungen in der Transformation sowie eine Diskussion, ob und inwieweit demokratische Beteiligung in der Arbeitswelt geeignet ist, diesen entgegenzutreten. Im ersten Teil werden internationale Perspektiven auf das Erstarken rechter und zugleich klimaskeptischer Parteien unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiter*innenklasse beleuchtet und im Länder- bzw. Nord-Süd-Vergleich diskutiert. Dabei fokussieren wir zunächst auf Europa und Deutschland; anschließend kontrastieren wir dies mit Argentinien, wo die extrem rechte Regierung Mileis ein antistaatliches, gewerkschaftsfeindliches und anti-ökologisches Regierungsprojekt repräsentiert, das unter Arbeiter*innen dennoch erhebliche Zustimmung findet. Im zweiten Teil fragen wir nach Ansatzpunkten für eine politische Praxis in der Arbeitswelt. Vorgestellt werden sowohl umfassende wirtschaftspolitische Transformationskonzepte als auch konkrete Fallstudien, die aufzeigen, unter welchen Bedingungen die demokratische Gestaltung von Transformationsprozessen miss- bzw. gelingt. Unter anderem wird die Rolle von Eigentumsverhältnissen und (fehlender) Mitbestimmung in unterschiedlichen Sektoren thematisiert.
Teil 2: Umbaupläne und Fallstudien
Max Knapp (AK Wien): Ein Umbau für die Vielen. Das Modell der Arbeiterkammer als dritte, demokratische Option neben fossilistischer Beharrung und entmündigender Transformation von oben
Andrea Müller (F.A.T.K., Universität Tübingen) & Maria Pfeiffer (SFB 294 „Strukturwandel des Eigentums“, Universität Jena): Kommunale Infrastrukturunternehmen im sozial-ökologischen Umbau. Sind Gemeinwohlorientierung und betriebliche Mitbestimmung Gelingensfaktoren?
Johannes Specht (WSI): „Erst kommt das Fressen, dann die Moral?“ Hindernisse und Möglichkeiten sozial-ökologischer Transformation in der Fleischwirtschaft
Einleitung und Moderation: Steffen Liebig (SFB 294 „Strukturwandel des Eigentums“), Universität Jena) & Stefan Schoppengerd (WSI)
Sprache: Der Workshop findet in hybrider Form auf Deutsch und Spanisch statt. Es gibt eine spanisch-deutsche Übersetzung beider Workshopteile via zoom. Wer in Berlin der spanischen Übersetzung folgen will, benötigt ein eigenes internetfähiges Endgerät (z.B. Smartphone) sowie dafür geeignete Kopfhörer.
Verantwortliche: Max Knapp (AK Wien), Steffen Liebig, Maria Pfeiffer & Anne Tittor (SFB 294 „Strukturwandel des Eigentums“, Universität Jena), Neva Löw & Stefan Schoppengerd (WSI), in Kooperation mit dem Momentum Institut & dem Netzwerk TraSAs
Workshop C2: Solidarische Allianzen in Grünheide – Realitäten, Möglichkeiten, Herausforderungen
In dem Workshop soll eine „Ökologie der Arbeit“ anhand der Tesla Autofabrik in Grünheide und der damit verbundenen Kämpfe und Widerstände betrachtet werden. Dazu möchte der Workshop Aktive der jeweiligen Kämpfe vor Ort zusammen und ganz praktisch in Austausch bringen. Sie sollen die Möglichkeit haben, von ihren Kämpfen zu berichten. Anschließend soll es vor allem um die Frage einer gemeinsamen Allianz gehen. Wir wollen darüber sprechen, welche praktischen Erfahrungen es miteinander gibt, vor welchen Herausforderungen solidarische Allianzen stehen und welche Möglichkeiten sie bieten. Abschließend sollen die Erfahrungen in Verbindung gesetzt werden zu allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen und Fragen der strategischen Vernetzung andernorts. Mit dem Workshop knüpfen wir an verschiedene Perspektiven auf Sorge(arbeit) an, eine (gegenseitige) Sorge für Arbeiter*innen und die Sorge für/mit Natur.
Sprache: Deutsch
Verantwortliche: Valeria Bruschi (Left Ecological Association), Friedemann Wiese (Promotionsstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung, HWR Berlin/BTU Cottbus-Senftenberg)
Workshop D2: Perspektiven auf Arbeit in der ökologischen Krise: Industriebeschäftigte im Spannungsfeld von Dekarbonisierung und Militarisierung
Arbeit spielt als grundlegender Bestandteil des täglichen Lebens eine wichtige Rolle bei der Herausbildung von politischen und normativen Orientierungen. Um zu verstehen, welche Einstellungen Industriearbeiter*innen gegenüber der ökologischen Krise haben, muss daher ihre betriebliche Realität als Lebenswelt stärker als bisher in den Blick genommen werden. Dabei ist zentral, dass sich die betriebliche Lebenswelt in der Industrie gegenwärtig in einem grundlegenden Wandel befindet. Neben der Digitalisierung sind die Dekarbonisierung sowie in jüngerer Zeit die Militarisierung treibende Kräfte des Wandels. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer angespannten geopolitischen Lage in Zeiten globaler Umbrüche. Die Veränderungsdynamiken treffen auf eine Situation, die seit vielen Jahren durch Arbeitsverdichtung, Standortschließungen und -verlagerungen sowie ständige interne Restrukturierungen geprägt ist. Gewerkschaften, Betriebsräte und Beschäftigte sehen sich in dieser Situation verstärkt in einem Dilemma zwischen Arbeitsplatzerhalt, gesellschaftspolitischen Ansprüchen und Anforderungen einer grundlegenden sozial-ökologischen Transformation. In dem Workshop wollen wir in den Blick nehmen, wie sich dieses Dilemma auf die Einstellungen der Beschäftigten auswirkt. Wir diskutieren erste Einsichten aus zwei Forschungsprojekten in einem transdisziplinären Kontext mit Vertreter*innen aus Wissenschaft, Betrieben und sozialen Bewegungen.
Sprache: Deutsch
Verantwortliche: Jenny Simon, Tobias Kalt, Markus Wissen (alle HWR Berlin), Rhonda Koch (wissenschaftliche Mitarbeiterin des Betriebsrats von VW Baunatal), mit Beiträgen von Stefan Nagel (Vertrauensmann der IG Metall bei BMW Leipzig), N.N. (Fridays goes industry)
Workshop E2: Welche Strategien für sozial-ökologische Transformationskonflikte? Lehren aus einer internationalen Auswahl von Fallstudien und aktuellen Auseinandersetzungen bei Volkswagen Osnabrück – Teil 2
Die jüngsten Entwicklungen in der Automobilindustrie haben erneut deutlich gezeigt, dass der Wandel der Branche längst auch die Fabriken erreicht hat: in Form einer Krise, die drastische Einschnitte für die Beschäftigten mit sich bringt, sei es durch den „sozialverträglichen” Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen oder durch die Schließung ganzer Werke, wie im Fall von Ford Saarlouis oder möglicherweise dem Volkswagenwerk in Osnabrück. Die jüngste Eskalation der Ereignisse bei Volkswagen zeigt einmal mehr, dass die traditionellen Instrumente für eine sogenannte „Just Transition“ im Rahmen einer sogenannten „Sozialpartnerschaft”, die seit langem die deutschen Gewerkschaften und Betriebsräte leiten, an ihre Grenzen stoßen. Um ein Betriebsratsmitglied zu zitieren: „Ein Zukunftstarifvertrag ist kein nachhaltiges Produkt.”
Teil 2: Der Fall Volkswagen Osnabrück
Der zweite Teil des Workshops konzentriert sich auf den Fall Volkswagen Osnabrück. Osnabrück ist ein Brennpunkt im Kampf um Konversion: hin zum Militär und zur Gewalt oder hin zu einer sozial-ökologischen Zukunft. VW will dort ab 2027 keine Autos mehr bauen. Rheinmetall hat das VW-Werk bereits als gut geeignet für den Bau von Militärfahrzeugen beschrieben. Wie ist die Situation im Werk und welche Wege sind in diesem Zusammenhang gangbar? Welche Lehren können wir aus den Auseinandersetzungen bei GKN Campi Campi Bisenzio, Mecaner im Baskenland und Mahle ziehen?
Sprache: Deutsch
Verantwortliche: Mario Candeias (Rosa Luxemburg Stiftung), mit Beiträgen von Stephan Krull (Koordinator Gesprächskreis Auto.Umwelt.Mobilität), Eckhardt Hirschbaum (Betriebsrat VW Osnabrück)
Workshop F2: Unterschiedliche Wege, gemeinsame Ziele: Aufbau von Basisorganisationen und Nutzung von Top-Down-Partnerschaften zwischen Gewerkschaften und Klimabewegungen – Teil 2
Dieser zweiteilige Workshop bringt Organizer und Wissenschaftler*innen zusammen, um aus drei primären Fallstudien zu lernen, die das Spektrum von basisgeführten Aktionen bis hin zu Top-Down-Erfolgen in der Politik durch organisatorische Partnerschaften abdecken. Trotz der Unterschiede in Bezug auf Branche, Land und Ansatz wird unsere gemeinsame Analyse dieser Bewegungen den Teilnehmenden strategische Erkenntnisse liefern. Beide Teile des Workshops können unabhängig voneinander besucht werden. Teilnehmernde, die die Wechselwirkungen zwischen Top-down- und Bottom-up-Strategien verstehen und praktische Erkenntnisse für ihre eigenen Herausforderungen gewinnen möchten, wird die Teilnahme an beiden Teilen empfohlen.
Part 2: Vom Rahmenwerk ausgehend – lokale Strategien mit Erkenntnissen aus Schottland gestalten
Diese interaktive Sitzung lädt die Teilnehmenden dazu ein, ihre eigenen Kontexte einzubringen. Wir werden untersuchen, wie einzelne Akteure – Aktivist*innen, Gewerkschafter*innen oder Arbeiter*innen – Top-down-Strukturen und verbindliche Vereinbarungen vorantreiben können, die die Organisation an der Basis und einen systemischen Wandel unterstützen. Ausgehend vom Rahmenwerk der Just Transition Partnership werden wir dessen Elemente auf die Fälle Italien und Deutschland anwenden. Wir werden untersuchen, wie das Engagement von Arbeiter*innen und Aktivist*innen Top-Down-Initiativen verstärken kann, und dabei Beispiele wie „Wir fahren zusammen” in Deutschland heranziehen. Abschließend werden wir gemeinsam mit den Teilnehmenden Strategien entwickeln, die diese Erkenntnisse widerspiegeln.
Die Teilnehmenden müssen nicht in der Gewerkschafts- oder Klimabewegung engagiert sein; wir werden Fallstudien für diejenigen bereitstellen, die aus anderen Perspektiven kommen oder über ihre unmittelbaren Kämpfe hinausdenken möchten.
Sprache: Englisch
Verantwortliche: Aaron Niederman (Stipendiat der Rosa Luxemburg Stiftung), Anne Möller (Europa-Universität Flensburg), Marco Caligari (University of Ferrara), Matthew Crighton (Just Transition Partnership)
17:30 Pause
18:00 Öffentliche Abendveranstaltung: Politik der sozial-ökologischen Transformation
Deutsch mit englischer Übersetzung
«Umwälzungen finden in Sackgassen statt.» Für eine Transformation sozial-ökologischer Transformationspolitik
Nora Räthzel, Umeå University
Sozial-ökologisch planende Wirtschaftspolitik als Weg aus der Vielfachkrise
Lukas Oberndorfer, Arbeiterkammer Wien
Moderation: Tobias Kalt, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
19:30 Abendessen und Get together
Dienstag, 2. Dezember
09:00 Vortrag und Diskussion: Just Transition im internationalen Vergleich
Deutsch mit englischer Übersetzung
Dennis Eversberg, Goethe-Universität Frankfurt am Main
Kommentar: Ulrich Brand, Universität Wien
Moderation: Jenny Simon, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
10:00 bis 11:45 Workshop-Phase III
Workshop A3: Staat, Kapital und Subalterne im Spannungsfeld eines Grünen Extraktivismus in Chile
Der Workshop diskutiert sozial-ökologische Konflikte im chilenischen Bergbausektor, die sich im Zuge der globalen Energiewende wandeln. Aus einer interdisziplinären Perspektive werden die Rollen von Staat und Kapital bei der umkämpften Reproduktion der kapitalistisch-extraktivistischen Ordnung und die Widerstände besonders seitens Gewerkschaften, Arbeiter*innen und indigenen Völkern analysiert. Diese wissenschaftliche Untersuchung trägt im besten Falle dazu bei, die politische Arbeit zu bereichern, indem die Verschränktheit von Konflikten um Arbeit, Natur und Lebensweisen aufgezeigt wird. Es wird zudem ein Raum geöffnet, um zu überlegen, wie sich Konflikte um und Bewegungen für Klimagerechtigkeit, Arbeiter*innenrechte und gegen glokale Ausbeutungsverhältnisse miteinander verbinden lassen. Zu Beginn werden Filmaufnahmen gezeigt, die die ökologischen und sozialen Folgen des Lithiumabbaus im chilenischen Salar de Atacama zeigen, eingeleitet und begleitet durch den Regisseur Juan Donoso. Im nächsten Schritt wird Nina Schlosser Ergebnisse ihrer Dissertation zum umkämpften Lithium-Extraktivismus in Chile präsentieren. Sie skizziert die vorherrschenden Kräfteverhältnisse und zeigt entlang der dominanten Strukturen, welche Widerstände und Widersprüche aus dem Ringen um einen Lithium-Konsens erwachsen und wie sie strategisch mit welchen Folgen bearbeitet werden. Daraufhin wird Andrés Alvarez spezifischer über die Rolle von Gewerkschaften in diesem Kontext reden, die oft im Dilemma gefangen sind, zwischen Arbeitsplätzen und Umweltschutz entscheiden zu müssen und eine ambivalente Rolle spielen. Schließlich soll Raum für eine offene Diskussion gelassen werden.
Sprache: Deutsch
Verantwortliche: Andrés Alvarez Falconí, Nina Schlosser (HWR Berlin, Universität Wien), Juan Donoso (Formando Rutas)
Workshop B3: Realistische Visionen versus utopischer Kapitalismus
Das technokratische Elite-Management weicht einem autoritären Voluntarismus. Dieser populäre Autoritarismus kann nicht auf der Grundlage des Status quo ante besiegt werden. Die Antworten müssen visionär und realistisch sein. Dem heutigen rationalen Realismus fehlt es jedoch an Visionen, während er gleichzeitig utopisch ist. Er basiert auf der impliziten Annahme, dass die Welt weiterhin um 3,5 % jährlich wachsen und die globale Produktion alle 20 Jahre verdoppeln kann. Ist Degrowth eine Alternative und was würde dies für die Wirtschaftspolitik bedeuten? Hansjörg Herr wird diskutieren, wie man den Spagat zwischen der Aufrechterhaltung einer dynamischen und innovativen Wirtschaft und der Beendigung der gewinnorientierten Logik des immer weiter steigenden Wirtschaftswachstums schaffen kann.
Je weiter die Umweltkrise voranschreitet, desto größer ist das Risiko, dass ökologisch diktatorische Regime zur Standardoption werden, um divergierende Interessen dem Gebot des ökologischen Überlebens unterzuordnen. Die Bereitschaft einer wachsenden Zahl von Regierungen, darunter auch westliche liberale Demokratien, ernsthafte Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte aufzugeben, ist in diesem Zusammenhang ein alarmierender Ausdruck der abnehmenden Bereitschaft, grundlegende Menschenrechtsprinzipien aufrechtzuerhalten und gleichzeitig nationale Interessen zu verfolgen. Frank Hoffer wird diskutieren, wie der Übergang von oft kritisierten Menschenrechts-Doppelmoral zu einer Welt ohne Standards einen stärker auf die Menschen und Solidarität ausgerichteten Ansatz anstelle eines staatszentrierten Ansatzes erfordert, um grundlegende Menschenrechte und demokratische Standards zu verteidigen und voranzubringen. Spontane einmalige Mobilisierungsaktionen haben sich als äußerst ineffektive Formen des politischen Protests erwiesen, die die Illusion von Widerstand vermitteln, ohne jedoch eine substanzielle Wirkung zu erzielen. Um über Ad-hoc-Mobilisierungen und bloßen Widerstand hinaus zu einer tiefgreifenden und nachhaltigen Organisation für den sozial-ökologischen Wandel zu gelangen, bedarf es eines Modells der permanenten, emanzipatorischen Arbeiterbildung. Die Global Labour University nutzt diesen Ansatz als Strategie, um Ideen, Wissen und Handeln zu verbinden. Edlira Xhafa wird die Erfahrungen der GLU mit Blended Learning als Möglichkeit vorstellen, Ideen und Visionen in die Tat umzusetzen.
Sprache: Englisch
Verantwortliche: Frank Hoffer, Edlira Xhafa (beide Global Labour University), Hansjörg Herr (HWR Berlin)
Workshop C3: Die „Teslaisierung“ der deutschen Automobilindustrie? Zum Wandel von Arbeit, Produktion und Beschäftigung
Die deutsche Automobilindustrie befindet sich in einer tiefen Krise. Während hiesige Endhersteller und Zulieferer sozialpartnerschaftliche Arrangements aufkündigen und Stellen streichen, etablieren sich neue chinesische und US-amerikanische Wettbewerber im Bereich der E-Mobilität auf dem Markt. Der Workshop beleuchtet diesen doppelten Umbruch aus ökologischer Modernisierung und geoökonomischer Machtverschiebung. Dabei stehen neben einem Überblick über die Auswirkungen der doppelten Transformation auf die Qualität von Arbeit und Beschäftigung an bestehenden Standorten auch neue Akteure im Mittelpunkt. Sowohl der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla als auch der chinesische Weltmarktführer im Batteriebau CATL haben Produktionsstandorte in Deutschland eröffnet. Die Tesla Gigafactory Grünheide und CATL Arnstadt haben jedoch für Negativschlagzeilen gesorgt: Beide Standorte zeichnen sich durch belastende Arbeit und hohe Personalfluktuation aus und gelten als mitbestimmungs- und gewerkschaftsfeindlich. Sind die beiden Unternehmen Vorreiter für eine folgenreiche Restrukturierung der deutschen Automobilindustrie? Nach drei kurzen Impulsvorträgen wollen wir gemeinsam Konflikte um den Wandel von Arbeit und Produktion und die Perspektive einer sozial-ökologischen Transformation in der (deutschen) Automobilindustrie diskutieren.
Sprache: Deutsch
Verantwortliche: Stefan Schmalz, Karla Zierold, Sophie Steidel, Sabrina Stangl, Mara Schaffer (alle Universität Jena)
Workshop D3: Arbeit, Ökologie und Vergesellschaftung: Historische Lehren und Perspektiven für industriellen Umbau von unten
Mit der intensivierten Debatte um das Verhältnis von Arbeit und Ökologie der vergangenen Jahre geht auch ein gesteigertes Interesse an den historischen Aushandlungsprozessen einher. Dennoch fokussiert die aktuelle Debatte oftmals eher die wenigen heute sichtbaren Positivbeispiele und bleibt damit entkoppelt von den historischen Kontinuitäten und dem reichen Erfahrungsschatz der Arbeiter*innenbewegung. Auch die Anzahl empirischer Studien zur Geschichte des Verhältnisses von Arbeit und Natur bleibt überschaubar. Dabei deutet die bisherige Forschung ein nicht zu unterschätzendes Potenzial historischer Perspektiven für die Suche nach Praxisformen und Strategien an, die den Krisen unserer Zeit angemessen sind. Das Potenzial besteht zum einen in der Rekonstruktion der Debatten und Erfahrungen der historischen Arbeiter*innenbewegung in Bezug auf Fragen des sozial-ökologischen Umbaus, der Wirtschaftsdemokratie und der Sozialisierung. Zum anderen birgt der Blick in die Vergangenheit Möglichkeiten, den Zusammenhang von Stoffwechselregimen und Arbeitsbeziehungen genauer zu untersuchen. Im Zentrum des Workshops steht daher die Frage, auf welche Art und Weise eine dezidiert historische Auseinandersetzung mit Arbeit, Ökologie und Vergesellschaftung leere Stellen der aktuellen labour environmentalism-Diskussion füllen und ergänzen kann. Inwiefern sind historische Kämpfe um Arbeit, Ökologie und Eigentum vergleichbar mit heutigen Auseinandersetzungen? Welche Bedingungen haben sich geändert, und inwiefern bedürfen historische Perspektiven einer Aktualisierung für die Krisen unserer Zeit? Welche Impulse lassen sich aus der Geschichte der Arbeiter*innenbewegung für ökologische Klassenpolitik gewinnen?
Sprache: Deutsch
Verantwortliche: Jary Koch (ZZF Potsdam), Maximilian Wilken (communia) mit Präsentationen von Daniela Russ (Universität Leipzig, angefragt), Ralf Hoffrogge (ZZF Potsdam/freier Autor, angefragt) und Jary Koch
Workshop E3: Mobilitätswende Produzieren!
Wie können öffentliche Investitionen in die Schieneninfrastruktur Wachstum und Beschäftigung fördern – und welchen Beitrag kann dabei die heimische Bahnindustrie leisten? Diesen Fragen widmet sich der Workshop „Mobilitätswende Produzieren!“. Auf Basis aktueller Ergebnisse einer Input-Output-Analyse für Österreich und Deutschland zeigen wir, welches wirtschaftliche Potenzial im Ausbau der Schieneninfrastruktur steckt. Ergänzend beleuchten wir in einer qualitativen Analyse die besonderen Eigenschaften der österreichischen Bahnindustrie: krisenresilient, innovativ, nachhaltig und geprägt von guten Arbeitsbedingungen – ein idealer Hebel für eine sozial-ökologische Transformation. Im Workshop werden zentrale Herausforderungen sowie politische Gestaltungsoptionen diskutiert. Nach einem inhaltlichen Input erarbeiten die Teilnehmenden in Kleingruppen konkrete politische Handlungsvorschläge zur Stärkung des Sektors. Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, wie der politische Wille zur Mobilitätswende gestärkt werden kann – damit die Bahnindustrie zum Motor einer sozial-ökologischen Wirtschaft wird.
Sprache: Deutsch
Verantwortliche: Laura Porak und Lukas Cserjan (Universität Linz)
Workshop F3: Baustelle Zukunft: Klima, Arbeit und Allianzen im Bausektor
Die Baubranche steht exemplarisch für die ökologische Krise der Arbeit, ob durch ihren Ressourcenverbrauch, die Flächenversiegelung und insbesondere durch die Betonproduktion, die allein für etwa acht Prozent der globalen CO?-Emissionen verantwortlich ist. Daher kommt es zunehmend zu Widerstand, von Protesten gegen Großprojekte und Autobahnen bis zu Blockaden von Kiesgruben und Zementwerken. Auch nimmt der Diskurs um eine “Bauwende” zu — weg von Stahlbeton und massenhaftem Neubau hin regenerativen Materialien und Bauen im Bestand. Doch die Perspektive der Beschäftigten in der Bauwirtschaft wird dabei meist ausgespart. Dabei sind Bauarbeiter*innen als “Klimaprekariat” nicht nur durch Feinstaub, zunehmende Extremwetter etc. besonders betroffen, sondern verfügen auch über das konkrete technische und soziale Wissen, das für eine sozial-ökologische Transformation zentral sein könnte. Deshalb möchten wir im Workshop nach möglichen Allianzen zwischen der Klima- und der Gewerkschaftsbewegung in der Baubranche suchen. Auf Grundlage von Inputs zu bestehenden Strategien (u.a. die „Heat Strike“-Kampagne in UK) sowie aus verschiedenen Perspektiven von Wissenschaft, Aktivismus und Gewerkschaften wollen wir strategische Ausrichtungen eines labour environmentalism in der Baubranche diskutieren. Zudem möchten wir die Entwicklung gemeinsamer Forderungen sowie möglicher Aktionsideen anstoßen – insbesondere im Hinblick auf care as resistance-Praktiken. Arbeitsweise: Kurze Inputs aus verschiedenen Perspektiven mit anschließenden Kleingruppendiskussionen und Sammlung im Plenum.
Sprache: Deutsch
Verantwortliche: Matthias Schmelzer (Europa-Universität Flensburg), Nils Urbanus (Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, End Cement)
11:45 Kaffeepause
12:15 Open space - Konzeption:
Saida Ressel, NELA. Next Economy Lab, Bonn
Katharina Keil, Universität Lausanne
Aaron Niederman, Rosa-Luxemburg-Stiftung
13:30 Mittagessen
14:30 Podium: Jenseits von Militarisierung und «grünem Kapitalismus». Kämpfe um die sozial-ökologische Transformation
Englisch mit deutscher Übersetzung
Mario Candeias, Rosa-Luxemburg-Stiftung
Julia Kaiser, Universität Leipzig
Hans-Jürgen Urban, IG Metall
Hilary Wainwright, The Institute of Development Studies, Sussex University, Mitherausgeberin Red Pepper Media
Markus Wissen, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Moderation: Janina Puder, Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg
16:30 Ende der Tagung
Anmeldung für die internationale Konferenz
Labour Environmentalism (01./02. Dezember 2025)
Vorläufiger Anmeldeschluss: Hier kannst Du Dich bis zum 17.10.2025 für die internationale Konferenz „Labour Enviromentalism“ anmelden. Bitte alles vollständig ausfüllen!
Link
Weitere Artikel, nach dem Datum ihres Erscheinens geordnet, zum Thema
Termine:
02.12.2025: Online: Auf Rechten basierende politische Prioritäten für alternde Gesellschaften in Europa
03.12.2025: Online: Altersfreundliche Kommunikation – Öffentlichkeitsarbeit für ältere Zielgruppen
05.12.2025: Bundesweit: Aufruf zum Schulstreik gegen die Wehrpflicht
Alle Artikel zum Thema
Termine
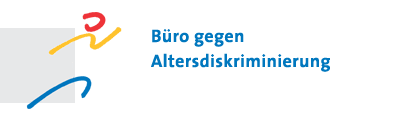
 Seite
drucken
Seite
drucken