Bernd Rürup über Rente + Pensionen - Interview Süddeusche 18.4.23
.jpg)
Foto: H.S.
27.04.2023 - von Hendrik Munzberg
Neid auf die Beamten
Angestellte erhalten im Alter deutlich geringere Bezüge als Staatsdiener. Rentenexperte Bert Rürup erklärt, warum das so ist und wie es in Österreich gelungen ist, Ungleichheiten zu korrigieren
Interview: Hendrik Munsberg
Wenige kennen die Alterssicherung Deutschlands und Österreichs so gut wie der frühere Chef
der Wirtschaftsweisen, Bert Rürup, 79.
Natürlich ist ihm auch der neidische Blick der Angestellten auf die Altersbezüge der Beamten vertraut. Wer verbeamtet ist, bekommt in Deutschland nach 40 Dienstjahren bis zu 71,75 Prozent jener Bruttobezüge, die er während der letzten zwei Dienstjahre vor dem Ruhestand erhielt.
Bei Angestellten dagegen zählt nur, was man im Durchschnitt seiner gesamten Versicherungsdauer eingezahlt hat. Rürup hat auch die österreichische Bundesregierung
beraten. Dort wagte man 2004 eine wegweisende Reform, die beide Berufsgruppen in einem System vereinigt.
SZ: Herr Professor Rürup, kaum etwas nährt solchen Neid wie das Versorgungsniveau von Beamtinnen und Beamten.
Warum ist das so?
Bert Rürup: Die Beamtenversorgung ist historisch sehr viel älter als unsere 1957 eingeführte gesetzliche Rentenversicherung, und sie beruht auf einem völlig anderen Prinzip: nämlich dem Alimentationsprinzip.
Was bedeutet das?
Durch die Beamtenversorgung soll der in den letzten Dienstjahren gewohnte Lebensstandard auch im Alter gewährleistet bleiben. Außerdem umfasst die Beamtenversorgung nicht nur die erste, sondern auch die zweite Säule der Alterssicherung, wie man sie bei gesetzlich Versicherten als betriebliche Zusatzversorgung kennt, aber auch von den Knappschaftsrenten der Bergleute.
Welchem Prinzip folgt die gesetzliche
Rentenversicherung?
Hier gilt seit 1957 das Äquivalenzprinzip. Es besagt: Die erworbenen Rentenansprüche richten sich nach den während des gesamten Erwerbslebens geleisteten lohnabhängigen Beitragszahlungen. Dabei haben die Beiträge, die von der Ausbildungsvergütung abgeführt werden, für die Rentenhöhe die gleiche Bedeutung wie die Beiträge auf die höheren Einkommen in den späteren Erwerbsjahren.
Viele Rentnerinnen und Rentner empfinden das als ungerecht.
Die Leistungen beider Systeme sind in der Tat sehr unterschiedlich. Beamte gibt es aber nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen Staaten der Welt. In den USA beispielsweise sind hoheitliche Funktionen wie etwa die von Richtern oder Militärangehörigen mit Beamten besetzt. Und auch dort gibt es deutliche Einkommensunterschiede, da von Beamten eine besonders hohe Loyalität gegenüber dem Staat erwartet wird.
Lassen Sie uns ein paar Fakten klären: Wie viel erhält ein durchschnittlicher Rentenbezieher in Deutschland monatlich?
Im Schnitt bekommt ein Rentner in Deutschland 1230 Euro und eine Rentnerin um die 800 Euro. Diese Durchschnittszahlen sind auch deshalb so niedrig, weil oftmals nur kurze Zeit Beiträge entrichtet wurden. Denn in Deutschland erwirbt man bereits Rentenansprüche, sobald man fünf Jahre Beiträge gezahlt hat. Viele Ältere leben aber nicht nur von dieser Rente, sondern sie haben als Folge ihrer Erwerbsbiografien auch andere Alterseinkünfte, beispielsweise Lebensversicherungen, Immobilieneigentum oder Betriebsrenten.
Wie sieht es bei den Beamten aus?
Die Mindestpension beim Bund beträgt gegenwärtig rund 1860 Euro. Voraussetzung dafür ist, dass ein Beamter mindestens fünf Jahre tätig war. Dafür muss ein Angestellter jahrzehntelang Beiträge zahlen. Eine wichtige Kennziffer ist die „Ersatzrate“ der Rente. Sie beschreibt, wie viel Rente ein Durchschnittsverdiener im Verhältnis zum letzten Arbeitsentgelt bekommt. Derzeit sind das in Deutschland knapp 42 Prozent. Rentner bekommen also im Schnitt nicht einmal die Hälfte dessen, was sie zuletzt verdienten.
Gemessen an dieser Bruttoersatzrate ist das Leistungsniveau unserer gesetzlichen Rente im internationalen Vergleich tatsächlich recht gering. In Österreich und Frankreich liegt diese Rate bei um die 75 Prozent. Fakt ist: Unsere gesetzliche Rente sicherte zu keinem Zeitpunkt den in den letzten Erwerbsjahren gewohnten Lebensstandard.
Deswegen gibt es ja zwei weitere Säulen: die betriebliche und die private Alterssicherung.
Diese „Ersatzrate“ ist auch deutlich geringer als das Rentenniveau, auf das SPD-Sozialminister Hubertus Heil immer abstellt und das er langfristig bei 48 Prozent stabilisieren will.
Aber auch dadurch wird die gesetzliche Rente aus meiner Sicht noch keine Alterssi- cherung, die im Wortsinn den am Ende des Erwerbslebens gewohnten Lebensstandard sichert.
Wie definieren Sie das Rentenniveau, von dem Heil spricht?
Das Rentenniveau beziffert die Höhe derjenigen gesetzlichen Rente, die jemand bezieht, der 45 Jahre lang immer den Durchschnittslohn verdient hat. Daher erlaubt die Kennziffer nur in sehr seltenen Fällen einen Rückschluss auf das Verhältnis der Rente zu dem in den letzten Arbeitsjahren bezogenen Arbeitseinkommen, das oft die Ansprüche im Alter bestimmt. Das Rentenniveau ist eine statistische Größe, die man wie eine Monstranz vor sich herträgt, obwohl sie sehr wenig über die Höhe einer individuellen Rente aussagt.
An vielen Schulen unterrichten Lehrerinnen und Lehrer, von denen die einen Beamte und die anderen Angestellte sind. Wie kommt das?
Ich halte das für einen Skandal, wenn an den gleichen Schulen Lehrer, die das Gleiche leisten, höchst unterschiedlich bezahlt werden und unterschiedlich sichere Arbeitsplätze haben. Das resultiert wohl aus der unterschiedlichen finanziellen Ausstattung der Kommunen.
Haben Politiker einen systematischen Grund, Beamtenstellen zu schaffen?
Solange ein Beamter im Dienst ist, ist er für den Staat durchweg billiger als ein Ange stellter. Denn für den Angestellten müssen von Anfang an auch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Richtig teuer für den Staat werden Beamte erst im Alter, weil sie dann eine Pension beziehen, die sich an den letzten Einkommen orientiert, und die Beihilfekosten stark steigen. Doch die Minister, die sie verbeamtet haben, sind dann in aller Regel längst nicht mehr im Amt.
Wozu und in welchen Bereichen braucht ein Staat unbedingt Beamte? Warum sind beispielsweise in den USA immer schon Richter Beamte mit komfortabler Versorgung gewesen?
Dadurch sollten diese Staatsbediensteten möglichst unbestechlich werden. Ähnliches gilt für gefahrengeneigte Berufe. Es gibt praktisch kein Land, in dem Polizisten oder hohe Militärangehörige nicht Beamte sind. Das hat auch damit zu tun, dass man bei Militär und auch Polizei keinen Staat im Staate schaffen will, der zur Bedrohung der inneren Sicherheit werden könnte.
Richtig. Beamte gibt es in fast allen Staaten. Sie sind teurer, man hofft aber, dass sie loyaler sind und dass es schwieriger wird, einen Beamten zu bestechen, wenn er um seine gute Altersversorgung fürchten muss.
Gilt das auch für Lehrer, weil der Beruf oft nervenaufreibend ist?
Der Beamtenstatus ist jedenfalls ein gutes Argument, um für die Schulen qualifiziertes Personal zu bekommen.
Und wie ist es bei Hochschullehrern? Den Beruf kennen Sie ja aus eigener An-
schauung als lang jähriger VWL-Professor in Essen und Darmstadt. Müssen Professoren Beamte sein?
Nein.
Österreich hat bereits 2004 eine Reform eingeleitet, um die Alterssicherungssys-
teme für Angestellte und Beamte zusammenzuführen.
Die lagen in Österreich aber nie so weit auseinander wie in Deutschland, Beamte haben dort immer schon „Beiträge für den Ruhegenuss“ an die Staatskasse gezahlt.
Sie haben als Rentenexperte auch Österreichs Regierung beraten. Wie sah diese Reform konkret aus?
Ich durfte Ende der 1990er-Jahre für die österreichische Bundesregierung eine Pensionsreform erarbeiten, die aber nur zu einem recht überschaubaren Teil umgesetzt wurde. 2004 gab es dann die tiefgreifende Reform, bei der die Alterssicherung für Angestellte und Beamte schrittweise zusammengeführt wurde: Wer als Beamter zum Stichtag über 50 Jahre alt war, blieb im alten System der Beamtenversorgung. Wer jünger war, für den wurden diebbis dahin in der Beamtenversorgung erworbenen Ansprüche festgeschrieben. Und für den Rest des Erwerbslebens wurden und werden Beiträge in die allgemeine Rentenversicherung gezahlt, die in Österreich Pensionsversicherungsanstalt heißt. Und es
gibt eine relativ lange Übergangsphase, die erst 2040 halbwegs abgeschlossen sein
wird. Das war nötig, um langfristig zu sparen und um den Übergang ins allgemeine
Rentensystem finanzieren zu können.
Ist das Beispiel Österreich nicht Beleg dafür, dass so eine Umstellung funktioniert?
Ja, eine Umstellung ist möglich, man darf aber nicht vergessen, dass man in Österreich – unabhängig von der Zusammensetzung der Regierung – bereit ist, für die Alterssicherung viel mehr auszugeben als in Deutschland. In Österreich belaufen sich die Ausgaben für Alterssicherung auf fast 16 Prozent des Bruttoinlandprodukts, in Deutschland sind es knapp 13. In Öster- reich ist das System generöser, weil es dort offensichtlich über die Parteigrenzen hinweg andere politische Prioritäten gibt.
Schon bald will Minister Heil Reformen für die gesetzliche Rentenversicherung präsentieren. Rechnen Sie mit einer Korrektur in Deutschland nach österreichischem Vorbild – im SPD-Wahlprogramm ist das angedeutet?
Definitiv nicht. Dazu steht unser gesetzliches Rentensystem in den nächsten zwei Jahrzehnten vor einer zu großen Bewährungsprobe. Zum Ende dieser Legislaturperiode kommt es zur bestprognostizierten Herausforderung dieses Systems: dem mindestens 15 Jahre anhaltenden massiven Alterungsschub, ausgelöst durch die ab Mitte der 1950er und in den 1960ern zur Welt gekommenen Jahrgänge der „Babyboomer“, die nun nach und nach in den
Ruhestand wechseln. Schon CDU-Sozialminister Norbert Blüm wollte dieser bereits
damals absehbaren Entwicklung begegnen: Am 9. November 1989 wurde seine Reform am Nachmittag von einer informellen großen Koalition verabschiedet, doch schon am Abend war sie Makulatur, als die Mauer fiel.
Und heute?
Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung kommt das Wort „Alterung“ nicht vor. Ich
nenne diesen Alterungsschub den sprichwörtlichen Gorilla, der im Wohnzimmer sitzt: Jeder sieht ihn, aber keiner spricht ihn an. Sicher ist: Am Ende der laufenden Legislaturperiode beginnt dieser Schub, und es wird schwierig genug, dieses Problem zu bewältigen. Da Beamte aus unterschiedlichen Gründen im Durchschnitt eine merklich höhere Lebenserwartung als
Arbeiter und Angestellte haben und daher auch länger Ruhestandsgeld beziehen, wird es bis auf Weiteres eine Integration der Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung nicht geben.
Weitere Artikel, nach dem Datum ihres Erscheinens geordnet, zum Thema
Rente:
20.03.2023: Plus in der Rentenkasse
13.03.2023: Gesetzlich Rentenversicherte sollen demnächst mit Aktien spekulieren
07.03.2023: Alterseinkünfte von Frauen 2021 fast ein Drittel niedriger als die von Männern
Alle Artikel zum Thema
Rente
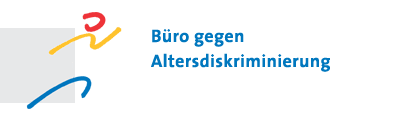
 Seite
drucken
Seite
drucken